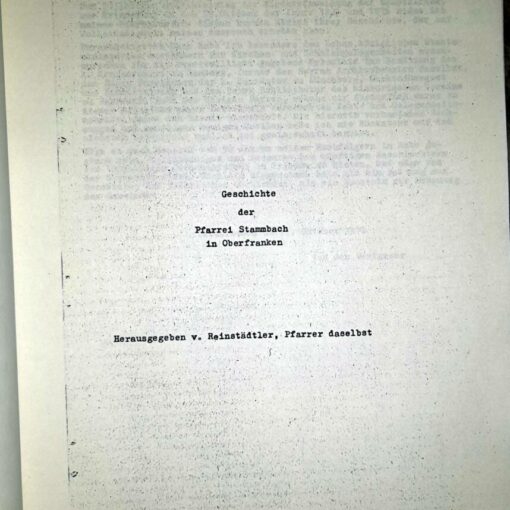Viele Weber aus der Region sind im 19. Jahrhundert nach Amerika ausgewandert. Doch der Mythos vom bitter armen Weber entspricht in vielen Fällen nicht der Wahrheit.
Es ist doch beeindruckend, wie lange sich die Heimweberei in unserer Region erhalten hat. Noch in den späten 1970ern war der Bayerische Rundfunk in unserer Gegend unterwegs – unter anderem in Gundlitz –, um Heimweber zu filmen – damals schon ein Relikt, das viele ausgestorben glaubten. Es ist noch beeindruckender, wenn man bedenkt, dass die Krise der Heimweberei eigentlich schon im 19. Jahrhundert einsetzte, mit der Industrialisierung. So heißt es in einem Bericht der Münchberg-Helmbrechtser Zeitung vom 19. März 1892: „Bezeichnend für die schlechten Aussichten in der Handweberei mag es sein, daß in einem kleinen Orte unseres Amtsbezirks, in Gundlitz, diese Woche sechs Weber mit einander nach Amerika auswanderten.“
Anders, als Marx dachte
Eigentlich gelten die 1850er-Jahre als die Zeit, in der es besonders viele arme Landbewohner nach Amerika drängte. Wobei es nicht immer an der klammen Kasse gelegen haben muss; Heimatforscher Helmut Hennig hat in seiner „Geschichte Stammbachs“ aufgezeigt, dass damals in den Zeitungen kräftig für die Auswanderung geworben wurde – es war eben auch ein Wirtschaftszweig, an dem manche verdienten. Laut Hennig gab es damals „Auswanderungs-Agenturen für Amerika“, die Verträge mit Reedereien abschlossen.
Das deutet auf einen wichtigen Punkt hin: Dass man nicht generell davon ausgehen kann, dass die Weber in unserer Gegend alle von extremer Armut betroffen gewesen wären. Bedeutende Erkenntnisse auf diesem Gebiet sind Adrian Roßner zu verdanken, der jüngst in seiner Doktorarbeit „Geordnete Moderne durch industrielle Entwicklung“ den Verlauf der Industrialisierung im Münchberger Raum untersucht hat. Er zeigt darin auf, dass die Industrialisierung im 19. Jahrhundert hier keinesfalls so abgelaufen ist, wie es sich mancher vorstellt. Viele haben das von Karl Marx und Friedrich Engels geprägte Bild der Industrialisierung im Kopf: Reiche Fabrikbesitzer beuten arme Arbeiter aus, die in Elendsquartieren dahinvegetieren. Dieses Bild mag auf die Verhältnisse in England teils zugetroffen haben – England war die Wiege der Industrialisierung, dort sahen Marx und Engels selbst vor Ort die Verhältnisse in den Industrievierteln. In unserer Region hingegen konnten die Weber, die von der Heimarbeit in die Fabrik wechselten, nun auf ein geregeltes Einkommen und teils auf soziale Absicherungen zählen – noch vor Bismarcks Reformen. Und sie hatten mehr Freizeit als in der Heimweberei. Die Fabrikbesitzer in unserer Gegend, auch in Stammbach, haben sich um ihre Arbeiter gekümmert. Doch für die verbliebenen Heimweber hatte die Industrialisierung eine Schattenseite.
In den Jahrhunderten davor hatte sich ein System etabliert, in dem die Heimweber fest eingebunden gewesen waren. Verleger importierten Baumwolle, ließen sie von den Heimwebern verarbeiten und verkauften die Produkte wieder. Von einer Ausbeutung konnte man auch hier laut Roßner nicht sprechen. Im 19. Jahrhundert setzte nach und nach die Industrialisierung ein, unter anderem durch die Einführung des Jacquard-Webstuhls und den Bau der Ludwig-Süd-Nord-Bahn. Das alte System wankte, brach schließlich zusammen.
Handwerkliches Geschick gegen Massenanfertigung
Die Schwierigkeiten der Hausweber spitzten sich ab den 1870ern zu, schreibt Roßner. „Aus den Webern, die noch vor zwei Generationen die Grundlage für den wirtschaftlichen Aufschwung gebildet hatten, waren Personen geworden, die man periodisch auf eine Stufe mit Tagelöhnern und Notleidenden setzte“ (S. 389). Und das bei einer Arbeitszeit von zwölf bis 14 Stunden am Tag. Um mit der mechanischen Weberei in den Fabriken zu konkurrieren, mussten die Handweber auf das setzen, was die Maschinen nicht konnten: die handwerkliche Kompetenz, die über Generationen hinweg angewachsen war. So konnten die Handweber beispielsweise komplizierte Textilien in kleiner Auflage anfertigen, während die Maschinen meist Ware „vom Band“ lieferten.
Insgesamt geht Roßner davon aus, dass es den Weberfamilien in normalen Zeiten möglich war, „eine wenigstens adäquate Lebensqualität zu genießen“ (S. 374). Allerdings ist das nicht mit dem vergleichbar, was man heute darunter verstehen würde – auf den Tisch kamen meist Kartoffeln, getrunken wurde oft Getreidekaffee. Auch hat die einseitige Haltung beim Weben verbunden mit dem ständigen Aufenthalt in der Wohnstube wohl oftmals zu Krankheiten geführt (S. 371). Und wirtschaftliche Krisen konnten schnell das Blatt wenden – eine solche gab es auch zur Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Auswanderung nach Amerika einen Höhepunkt erreichte. Wie viele Amerika-Emigranten hier einfach kein Auskommen mehr fanden und deshalb auswandern mussten und wie viele auch hier hätten überleben können, sich aber schlicht etwas mehr vom Leben erhofften, wird wohl im Nachhinein nicht mehr zu klären sein.
Quellen:
Der Auszug aus der Münchberg-Helmbrechster Zeitung stammt aus dem Archiv des Heimatforschers Karl Dietel bzw. dem Stadtarchiv Münchberg.
Adrian Roßner. Geordnete Moderne durch industrielle Entwicklung. (2023)
Helmut Hennig, Geschichte Stammbachs von den Anfängen bis zur Reichsgründung. (1989)
Karl Walther, „Stammbacher in der Neuen Welt“. Erschienen in: Stammbacher Lesebuch. Geschichten und Geschichtliches. Teil 1. (1999)